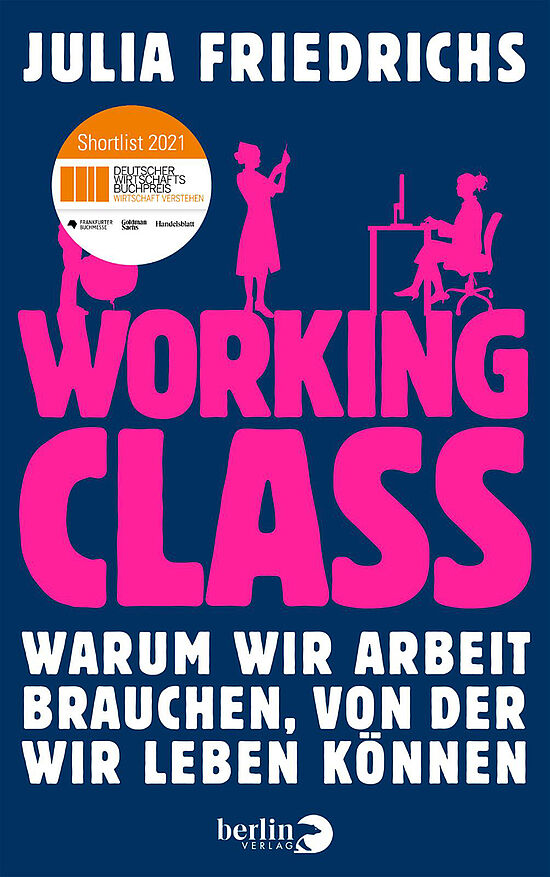Vorabveröffentlichung aus dem Sammelband „Welche Öffentlichkeit brauchen wir? Zur Zukunft des Journalismus und demokratischer Medien“
Der Sammelband „Welche Öffentlichkeit brauchen wir? Zur Zukunft des Journalismus und demokratischer Medien“ fragt anlässlich des Stiftungsjubiläums, was Demokratisierung – ein wichtiges Thema in den Reden Otto Brenners – mit Blick auf Medien und Öffentlichkeit gegenwärtig heißen kann.
In ihrem Beitrag „Eine Klasse für sich? Wieso Akademiker:innen die Redaktionen beherrschen“ zeigt Julia Friedrichs auf, wie arme Menschen strukturell vom Beruf des Journalisten ausgeschlossen werden – und macht deutlich, dass sich daran etwas ändern muss.
Eine Klasse für sich? Wieso Akademiker:innen die Redaktionen beherrschen
Ein Beitrag von Julia Friedrichs

Es ist ein Problem von Aufsteiger:innengeschichten, dass ihnen immer eine Botschaft innewohnt: „Seht her, es geht doch!“ Eine Botschaft, die zugleich individuell wahr, strukturell aber komplett falsch ist.
In den letzten 50 Jahren hat sich die Medienwelt modernisiert und in manchem zum Guten gewandelt. Nehmen wir die Lage von Journalistinnen. Die 1970er waren das Jahrzehnt, in dem der Chefsprecher der ARD beispielsweise noch behaupten konnte, Frauen seien zu emotional um Nachrichten zu verlesen.
Noch längst ist nicht alles gut. Aber solche Zeiten sind vorbei. Auch, weil Journalistinnen zum Beispiel im Verein Pro Quote für gleiche Chancen gekämpft haben. Genau, wie es seit einigen Jahren Menschen mit Migrationsgeschichte im Zusammenschluss Neue deutsche Medienmacher*innen tun. Ihrer aller Forderung: Redaktionen müssen ein Abbild der Gesellschaft sein, über die sie berichten.
„Bei Diversity geht es nicht um Nettigkeit oder nur um Teilhabechancen für alle. Mehr Vielfalt bringt neue Zielgruppen und vor allem einen besseren, erfolgreicheren Journalismus“, sagt Konstantina Vassilou-Enz, die Geschäftsführerin der Neuen deutschen Medienmacher*innen.
Die Gratwanderung, das vorab, die dieser Text versuchen wird, ist, keine Ungleichheit gegen die andere auszuspielen. Trotzdem ist festzustellen, dass die Diversity-Diskussion einen Bereich weitestgehend ausblendet – oder sollte man sagen: eine Dimension?
Zwar wurde schon im Jahr 2006 die Charta der Vielfalt verabschiedet. Eine Selbstverpflichtung von Arbeitgeber:innen, die Diversität in den Belegschaften zu fördern. Auch eine sehr lange Reihe von Medienunternehmen gehört zu den Unterzeichnern: das ZDF zum Beispiel, sämtliche ARD-Anstalten, Die ZEIT, auch der Axel-Springer-Verlag. Sie alle versprachen darauf zu achten, keine Angestellten zu diskriminieren und lieferten gleich sechs Kategorien mit, in denen Vielfalt nun Unternehmensziel sein sollte: Alter, ethnische Herkunft und Nationalität, Geschlecht und geschlechtliche Identität, körperliche und geistige Fähigkeiten, Religion und Weltanschauung, sexuelle Orientierung.
Dass auf dieser doch recht üppigen Liste ein nicht ganz unwesentlicher Punkt fehlte, schien fünfzehn Jahre lang nicht unangenehm aufzufallen: Die Tatsache, dass uns neben Geschlecht, Religion, Hautfarbe usw. noch ein anderer wesentlicher Faktor prägt, nämlich unsere wirtschaftliche Lage, unsere Klassenzugehörigkeit, wurde ausgeblendet. Erst Anfang 2021 wurde die Charta der Vielfalt um eine siebte Dimension erweitert: die soziale Herkunft.
Dabei sind die Defizite in diesem Bereich offensichtlich. Redaktionen sind immer noch das Refugium der gehobenen Mittelschicht. Als der Eliteforscher Michael Hartmann (2018) die soziale Herkunft der Medienelite untersuchte, war das Ergebnis ähnlich eindeutig wie beim Blick auf andere Branchen: Die Chefs der großen Medienunternehmen seien vor allem Männer aus „gutem Hause“, stellte Hartmann fest. Zwei Drittel von ihnen seien in Familien geboren worden, die zu den obersten vier Prozent der Bevölkerung gehörten. Männer aus gutem Hause. Wäre das Ziel der Vielfalt wirklich erreicht, wenn die Hälfte von ihnen durch Frauen aus „gutem Hause“ ersetzt würden? Oder ein Drittel durch Menschen mit Migrationsgeschichte, die aber auch zu den obersten vier Prozent der Gesellschaft gehörten? War und ist die Diversity-Diskussion im Journalismus also ökonomisch blind? Und wenn ja: Warum ist das so? Und welche Folgen hat es für die Berichterstattung?
I. Students only
„Codes, die ich nicht gut kann: Restaurantcode, Universitätscode, Theatercode, Bibliothekscode, im Studium habe ich XY gelesen-Code. Denn, jetzt kommt’s: ich habe nicht studiert. Ich wollte studieren, konnte aber nicht. Das konnten wir uns nicht leisten.“ Das schreibt Mareice Kaiser (2022) in ihrem Text „Mein Leben ohne Harvard-Hoodie“.
Kaiser wollte Journalistin werden, seit sie schreiben kann. Ihr Vorbild war Karla Kolumna, die rasende Reporterin in Benjamin Blümchens Neustadt: Immer informiert, immer dort, wo gerade etwas passiert, Dreh- und Angelpunkt. Kaiser arbeitete als Jugendliche frei. Aber nach dem Abitur schien ein unüberwindbares Hindernis zwischen ihr und dem Journalismus zu stehen. Denn sie sei sicher gewesen, dass für den Beruf ein Studium nötig sein würde, sagt Kaiser. Ebenso klar war die Aussage ihrer Eltern, LKW-Fahrer der Vater, Hausfrau die Mutter: „Das können wir uns nicht leisten.“ Sie habe ins Kissen gebissen, getobt und es dann anders probiert, sagt Kaiser im Gespräch mit dem Medienpodcast „Hinter den Zeilen“(2022). Zählen, wie oft sie in Redaktionen gefragt worden sei, wo und was sie studiert habe, könne sie nicht. Auch nicht, wie oft der Blick entgleist sei, wenn sie antwortete: nirgendwo oder nichts. Scrollt man sich durch die Lebensläufe der aktuellen Volontär:innen einiger ARD-Sendeanstalten, liest man, von welcher Norm Kaiser abwich. Immer wieder steht da:
„Studium der Publizistik-, Kommunikations- und Politikwissenschaft“ oder „Bachelor in Politik- und Theaterwissenschaft“ oder „Ich habe Germanistik in Tübingen, Berlin und Wien studiert“ oder „Deutsche Sprache und Literatur sowie Linguistik und Phonetik“ oder: „Später zog er für den Master nach Hamburg - halbjähriger Zwischenstopp in Skandinavien.“ Als kürzlich die Volontär:innen von Deutschlandradio, Deutsche Welle und ARD nach ihrer Vorbildung gefragt wurden, antworteten 95 Prozent, sie hätten studiert (Kraemer et al. 2020). Vor dem Hintergrund, dass ein Studium noch immer ein soziales Raster ist – von 100 Kindern aus nichtakademischen Familien beginnen nur 27 ein Studium, unter den Akademikerkindern sind es 79 (Kracke et al. 2018) – eine bemerkenswerte Verzerrung.
Es ist die erste Tür, die der Journalismus weitestgehend schließt. Wenn auch nicht mehr mit demselben lauten Knall, wie noch vor zehn Jahren. So sagte zum Beispiel der Volontariats-Verantwortliche der Süddeutschen Zeitung im Jahr 2011 auf die Frage, welche Voraussetzungen Bewerber:innen bräuchten: „Abgeschlossenes Studium muss sein, am liebsten Master-Abschluss.“ (Meedia 2011) 2020 schien er sich dann über den Erfolg seiner eigenen Vorgabe zu wundern: „Leider bewerben sich fast nur Menschen mit Studium“, schreibt er in einer SZ-Werkstatt zum Thema Volontariat. „Doch eigentlich stünden einer Redaktion auch Menschen mit abgeschlossener Lehre gut an.“
(Fries 2020) Die anderen Türen, die Redaktionen Menschen, in deren Familien es wenig oder keine finanziellen Reserven gibt, vor der Nase zuknallen, sind schwieriger zu beschriften. Vielleicht sollten schlicht „Geld“ und „Habitus“ auf den Klingelschildern stehen?
II. Entrance fee
Mareice Kaiser hatte es zwischenzeitlich zur Chefredakteurin des Online-Magazins Edition F gebracht, inzwischen verantwortet sie als Digitalchefin den Online-Auftritt des Schweizer Magazins Annabelle. Sie ist Autorin zweier Sachbücher. Es ist ihr also geglückt, sich durch den schmalen Spalt, der ohne Studium nur noch offen war, hindurchzuwinden. „Kurvig“ sei ihr Weg gewesen, sagt Kaiser. Sie machte eine Ausbildung als Mediengestalterin, ein Volontariat bei einer Corporate-Publishing-Agentur. Beides gefiel ihr. Aber der Wunsch nach der Karla-Kolumna-Welt verblasste nicht. Sie machte sich also dran, die nächste Hürde, die der Journalismus zwischen sich und den Nachwuchs gebaut hat, zu nehmen: sie absolvierte Praktika.
„Ohne Praktikum läuft (fast) nichts mehr“, schreibt der Deutsche Journalisten-Verband (o.J.) in seiner Handreichung an Berufsanfänger:innen. Der Spiegel erwartet laut einer Stellenausschreibung, die das Katapult-Magazin zitiert (Katz 2021), schon für ein Praktikum „redaktionelle Erfahrung durch mehrere absolvierte Praktika in anderen Medienhäusern“, genau wie der Focus: Wer dort ein Praktikum machen will, muss zuvor mindestens zwei andere Praktika absolviert haben. Aber obwohl 2015 der Mindestlohn eingeführt wurde, müssen freiwillige Praktika erst bei einer Länge von über drei Monaten honoriert werden – und Pflichtpraktika sind unbezahlt, egal wie lange sie dauern.
Ein paar Beispiele? Der öffentlich rechtliche Jugendsender Fritz pries sein Angebot so an: „Der RUNDFUNK BERLIN BRANDENBURG zahlt Praktikantinnen und Praktikanten kein Arbeitsentgelt, keine Ausbildungsbeihilfe und keinen Unterhaltszuschuss. Dafür bietet Fritz ein gutes Arbeitsklima und viele neue Erfahrungen.“ (ebd. 2021) Die taz (o.J.) lobt sich dafür, 110 Praktikumsplätze im Jahr anzubieten. Die Konditionen? »Aufwandsentschädigung von 200 Euro monatlich, ein taz-Freiabo für die Zeit des Praktikums und günstige Kantinenpreise als MitarbeiterIn«.
Und das ZDF feierte sich kürzlich dafür, dass man, „jungen Menschen das Sammeln von Erfahrungen und eine Mitarbeit im ZDF unabhängig von ihrer finanziellen Situation, ihrem sozialen Status und ihrem kulturellen Hintergrund“ ermögliche. „Endlich! Dafür haben wir echt lange gekämpft!“, hieß es in der Mitteilung. „Ab 1. Juli 2021 werden alle Praktika beim ZDF im Inland – unabhängig ob es sich um Pflicht- oder freiwillige Praktika handelt und unabhängig von einer Mindestdauer – mit 350 Euro pro Monat vergütet.“ (David 2021)
Gutes Arbeitsklima, ein taz-Freiabo, immerhin 350 Euro im Monat - das alles ist besser als nichts. Aber das alles löst nicht das grundsätzliche Problem: Wer Praktika nicht oder kaum bezahlt, setzt voraus, dass die Praktikantinnen nicht für ihr Tagwerk honoriert werden müssen, weil sie für Miete, Essen und Transport über andere Geldquellen verfügen – unausgesprochen werden die meisten Redaktionen dieses Geld bei Eltern oder Großeltern vermuten. Oder wie es die Journalistin Luisa Thomé formulierte: „Journalismus geht nicht ohne Praktika. Und Leben in Mainz, München, Hamburg geht nicht ohne Geld. Das Ergebnis: Elitärer Bubble-Journalismus oder verschuldete Berufseinsteiger:innen.“ (Thomé 2021) Im bereits erwähnten Podcast „Hinter den Zeilen“ berichten Arbeiterkinder von ihrem Weg in den Journalismus. Das unbezahlte Praktikum ist Dauerthema. Wie soll das gehen, wenn man eigentlich in den Semesterfeiern jobben muss, um das Studium zu bezahlen? Wie viele Praktika nimmt man auf sich, wenn man für jedes monatelang vorarbeiten muss?
Mareice Kaiser konnte sich ihre Praktika nur leisten, weil sie nach der ersten unbezahlten Schicht in der Redaktion noch eine zweite, gegen Geld, im Biosupermarkt dranhängte. Davon zu erzählen, traute sie sich damals nicht. Sie wollte nicht auffallen. Denn sie war sicher, dass die Karla-Kolumna-Zukunft in noch weitere Ferne rücken würde, wenn ihre Kolleginnen erführen, welche Sorgen es in der Mareice-Kaiser-Gegenwart gab.
III. Closed shop
„Es ist doch so: Wenn Du schlau bist, aber Geld verdienen musst, gehst Du eher nicht in den Journalismus, auch weil Du vorher X unbezahlte Praktika machen sollst“, sagt Anna Mayr. Mayr, 1993 im Ruhrgebiet geboren, entschied sich zum Glück anders. Dabei war Geld in ihrem Leben sehr lange sehr knapp, ihre Kindheit von Verzicht geprägt: „Ich verzichtete auf die Abi-Reise nach Spanien, ich verzichtete auf neue Kleidung. Meine Familie verzichtete auf ein Auto, auf Urlaub sowieso, verzichtete auf Avocados, verzichtete auf eine Wohnung, in der es ein Elternschlafzimmer gab.“
Mayrs Eltern waren arbeitslos, langzeitarbeitslos. Heute ist sie Politikredakteurin bei der ZEIT. Zwei Sätze, die sich in dieser Reihenfolge statistisch fast ausschließen. Denn ein Weg, wie er Anna Mayr gelang, glückt den allermeisten nicht. Es ist ein Problem von Aufsteiger:innengeschichten wie ihrer, wie der von Mareice Kaiser oder der von Daniel Drepper, von dem später in diesem Text noch zu lesen sein wird, dass ihnen immer eine Botschaft innewohnt: „Seht her, es geht doch!“ Eine Botschaft, die zugleich individuell wahr, strukturell aber komplett falsch ist.
Denn: „Klassenpositionen werden in Deutschland immer noch vererbt“, so lautet die äußerst robuste Diagnose von Bildungsforscher:innen (vgl. Pollak 2021). Ein Kind, das in Armut aufwächst, besucht – selbst bei guten Leistungen – vielfach seltener das Gymnasium als wohlhabende Kinder, verlässt es noch seltener mit dem Abitur, hat nochmals geringere Chancen ein Studium zu beginnen und auch zu beenden.
Anna Mayr ist es gelungen, all diesen Wahrscheinlichkeiten zu trotzen: Als sie aufs Gymnasium ging. Als sie dort bis zum Abitur blieb, obwohl das Jobcenter nach der zehnten Klasse Druck gemacht und ihren Eltern nahegelegt habe, das Kind doch in eine Ausbildung und damit aus der Bedarfsgemeinschaft zu schicken. Als sie ihr Studium begann und auch beendete. Allemal, als sie von der Studienstiftung des deutschen Volkes in die Begabtenförderung aufgenommen wurde. Eine „Schwarzer Schwan“-Vita.
Trotzdem, sagt sie, sei der erste Ort, an dem sie tatsächlich den Eindruck gehabt habe, dass keiner eine Herkunft wie die ihre teile, der Klassenraum der Deutschen Journalistenschule in München gewesen.
Praktika sieben den Nachwuchs nach sozialer Herkunft. An den Journalistenschulen, für viele noch immer der Ausbildungsort der journalistischen Elite vor allem bei Zeitungen und Zeitschriften, scheint die Lochung noch mal feiner zu sein.
In den Lokalredaktionen im Ruhrgebiet, in denen sie zu schreiben begann, seien ihr die Kolleg:innen noch recht nahe gewesen, sagt Mayr. Nun aber waren die Eltern des einen Mitschülers Geschäftsführer, die des anderen hatten ein Ferienhaus. Während die anderen von ihren Praktika in Washington erzählten, sprach Anna Mayr nicht über ihre Erfahrung beim Kölner Boulevardblatt Express. „Ich bin eigentlich kein stiller Mensch“, sagt sie. „Aber ich habe die ersten Wochen gar nicht geredet. Ich habe gedacht: ,Ich will das gar nicht machen. Es war ein Fehler’“.
Die einzige umfassende Studie zur Herkunft von Journalistenschüler:innen ist leider schon älter, aus dem letzten Jahrzehnt. Klarissa Lueg (2012) hat in ihrer Doktorarbeit untersucht, aus welcher Schicht die damals aktuellen Jahrgänge dreier Journalistenschulen stammten. Mehr als zwei Drittel ordnete sie einem „hohen“ Herkunftsmilieu zu (Ärzte, Unternehmerinnen, Professoren), die Eltern waren Akademiker:innen, überdurchschnittlich häufig promoviert oder habilitiert. Der Rest: gehobene Mitte. Kinder von Arbeiter:innen oder Arbeitslosen fand Lueg in ihrer Stichprobe nicht.
Ob das heute immer noch so ist? Das wüsste man gern. Die Deutsche Journalistenschule (o. J.), an der Mayr lernte, schreibt auf ihrer Homepage allerhand Statistisches über den aktuellen Jahrgang: Dieser bestünde zu 53 Prozent aus Frauen, zu 47 Prozent aus Männern, erfährt man. „Im Schnitt kamen 78 Prozent aus einer Großstadt, 22 Prozent kamen vom Land. 75 Prozent gaben an, sie hätten schon Auslandserfahrung. Zehn Prozent waren Deutsche mit einem sogenannten Migrationshintergrund; weitere sechs Prozent kamen aus dem Ausland. Vier von fünf hatten schon ein Praktikum gemacht, bevor sie sich bei der DJS bewarben.“ (ebd.) Alles spannend. Aber zur siebten Ungleichheitsdimension schweigt man auch hier. Auf Nachfrage teilt die Deutsche Journalistenschule mit, man habe keine Daten zur sozioökonomischen Herkunft erhoben, verweist aber auf eine Abschlussarbeit.
Matthias Kirsch (2019) hat für seinen Master untersucht, aus welchem Milieu die Bewerber:innen des Jahrgangs 2019 stammten. Er schreibt: „Die vorliegende Studie kommt zu dem Schluss, dass die Gruppe der Bewerber an der Deutschen Journalistenschule tatsächlich eine sozial sehr homogene Gruppe ist“. Schon die Interessent:innen stammten mehrheitlich aus der „höchsten Herkunftsgruppe“, sprich, gut situierten Familien. Die Eltern haben in der Regel studiert, etliche promoviert, Professor:innen sind vertreten. Die Mittelschicht ist unterrepräsentiert, Kinder aus ärmeren Familien bewerben sich kaum. Drei Viertel der Bewerber:innen wuchsen in Häusern oder Wohnungen auf, die im Eigentum ihrer Familien waren, weniger als ein Fünftel in Mietwohnungen – in der deutschen Gesamtbevölkerung lebt hingegen jeder Zweite zur Miete. 70 Prozent der Bewerber:innen gaben an, dass Geld in ihrer Familie nie knapp war. 85 Prozent schätzten, dass es bei Ihnen zu Hause mehr als 100 Bücher gab. Ein Wert, der vier Mal höher ist, als der geschätzte deutsche Durchschnitt. „Wie elitär die Gruppe der Bewerber ist, wird deutlich, wenn sie mit […] Promotionsstudierenden verglichen werden“, schreibt Kirsch: nicht mal dieser sozial exklusivste Kreis toppt die soziale Herkunft der Bewerberinnen an der Deutschen Journalistenschule.
Noch schwieriger ist, vollumfänglich zu beantworten, warum das so ist. In der Bildungsforschung hat sich ein Bild bewährt, das hilft: das der „leaking Pipeline“, der leckenden Röhre, die zum Bildungserfolg führt. Während Kinder aus wohlhabenden Akademikerfamilien recht problemlos hindurchgleiten, tropfen die anderen Meter für Meter heraus, auf dem Weg zum Abitur und zur Uni, während des Studiums, hin zu einer möglichen Promotion. Von 100 Kindern, deren Eltern studiert haben, studieren 79. Von 100 Kindern, deren Eltern nicht studiert haben, sind es lediglich 27. Während zehn Prozent der Akademikerkinder einen Doktor machen, ist es unter Arbeiterkindern nur eines von 100. Auch das Rohr, das in die Journalistenschulen führt, scheint zu lecken. Warum? Zum einen, weil – wie man aus der Forschung weiß – die Herkunft ein ganz entscheidender Faktor dafür ist, wer sich in Auswahlprozessen Chancen ausrechnet und wer nicht.
Anna Mayr sagt, dass sie sich fast nicht in München beworben hätte, weil sie auf der Homepage gelesen habe, die DJS gehöre zu den besten Journalistenschulen in Deutschland. „Ich habe dann gedacht: ,Dann ist es nicht für mich.’ Weil irgendetwas, was mit ,das Beste’ tituliert ist, ist nicht für mich.“ Nur weil Mentor:innen sie ermunterten, traute sie sich schließlich doch.
Anna Mayr tunte ihr Allgemeinwissen. „Das geht relativ gut, mit Wikipedia: Europäische Kommission, Orchidee des Jahres.“ Aber es blieben Lücken: „Alles, was mit Opern ist, wusste ich halt nicht.“ Weiches Wissen lässt sich kaum nacharbeiten: „Es gibt Bereiche, die man sich schwer anlesen kann“, sagt auch Ann-Kathrin Müller, die zu den wenigen Spiegel-Redakteurinnen gehört, die aus einem Nicht-Akademikerhaushalt stammt. „Das ist klassische Musik, Kunst, Theater: Ich wusste auch mit 25 nicht, welche Symphonie da läuft.“
Nur ein paar der Bausteine, aus denen sich das formt, was die Soziologie als ‚Habitus‘ bezeichnet, der Marker unserer Herkunft und gleichzeitig ein ziemlich großes Leck in der Pipeline. In der Oberklasse gehört dazu eine Bewandtheit in der Hochkultur, ein weltgewandter Gestus, eine gewisse Souveränität bei bestimmten Small-Talk-Themen – all die Codes, die Mareice Kaiser beschreibt. Der Habitus sorgt dafür, dass sich in Auswahlprozessen sozial ähnliche Menschen erkennen, sich als vertraut empfinden und damit – häufig auch unbewusst – als geeignet. Der Habitus ist Treiber des sogenannten Thomas-Kreislaufes, der beschreibt, dass ein weißer, gut situierter Mann, ein Thomas, als Verantwortlicher in Entscheidungspositionen einen anderen Thomas nachzieht.
Wer möchte, dass Redaktionen kein Thomas-Refugium sind, weil sie auch nicht für eine Thomas-Welt schreiben und senden, muss diesen Kreislauf durchbrechen wollen. Meines Erachtens ist das, wie oben beschrieben, was Frauen angeht, in Teilen gelungen: Der Thomas-Kreislauf wurde um einen zweiten, allerdings schwächeren Christine-Nele-Annika-Kreislauf ergänzt. Was Nachwuchs mit Migrationsgeschichte betrifft, ist ebenfalls angekommen, dass sich etwas ändern muss, selbst, wenn es in der Umsetzung noch stärker hapert. Wo aber bleiben in all diesen Kreisläufen die, deren Familien arm, deren Unibesuch unbezahlbar, deren Habitus nicht upper, sondern working class ist?
III. For the sake of Journalism
Dass es ihn gibt, diesen anderen Habitus, spüre man schnell, sagt Daniel Drepper. Er habe, kaum war er an der Uni, gemerkt, dass er sich von vielen Anderen unterscheidet, „in der Art, wie ich mich ausdrücke und gebe. Mir fehlten die Anknüpfungspunkte, die Kontexte, der Habitus“ eben.
Daniel Drepper, inzwischen stellvertretender Leiter des Rechercheverbunds von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung, hat in den vergangenen Jahren so viele Ehrungen angehäuft, dass er damit einen ganzen Raum dekorieren könnte: Wächterpreis, Reporterpreis, Ernst-Schneider-Preis. Er war Newcomer des Jahres, Chefredakteur des Jahres, 2021 wählte ihn das Netzwerk Recherche zum Vorsitzenden.
„Der Weg in den Journalismus war ein weiter“, sagt Drepper dennoch. Auch er ist, wie er es selber nennt, Arbeiterkind, der Vater Kfz-Mechaniker, die Mutter Bürokauffrau. Niemand bei ihm zu Hause habe die Zeitung, für die er heute arbeite, die Süddeutsche, gelesen, auf dem Küchentisch lagen weder ZEIT noch Spiegel. Er war der Erste in seiner Verwandtschaft, der studierte. Die Zeit an der Uni finanzierte Drepper selbst, genau wie seine Praktika. Einen Teil konnte er bei der Lokalzeitung erarbeiten, aber noch als Chefredakteur der Plattform BuzzFeedNews habe er die Schulden abbezahlt, die er während seiner Ausbildung anhäufte.
„Ich glaube, dass es drei Hauptgründe dafür gibt, warum Klasse in der Diversity-Diskussion bis heute kaum eine Rolle spielt“, sagt Drepper. „Erstens ist der soziale Hintergrund oft weniger sichtbar als ein Migrationshintergrund oder die fehlende Repräsentation von Frauen. Diese Unsichtbarkeit macht es Arbeiterkindern zweitens möglich, ihren Hintergrund zu kaschieren. Ich glaube, dass viele Menschen aus niedrigeren sozialen Klassen hart daran arbeiten, diese Unterschiede unsichtbar zu machen. Bei mir war das in den ersten Jahren definitiv der Fall. Drittens sehe ich keine prominenten Vorbilder, die eine Diskussion über Klasse im Journalismus antreiben. Das sorgt für ein fehlendes Bewusstsein“ – bei allen Beteiligten, könnte man ergänzen. Denn während man heute (zum Glück), anders als in den 1970er Jahren, nicht mehr ausufernd argumentieren muss, warum Frauen geeignet sind, Nachrichten zu sprechen und Reporterinnen oder Redakteurinnen zu sein, während die weite Mehrheit der Chefredakteure sich heute dafür ausspricht, Teams bilden zu wollen, die sich aus Männern und Frauen, aber auch aus Schon-immer- und aus Noch-nicht-so-lange-Deutschen oder aus Stadt-und-Land-Menschen mischen, bleibt die soziökonomische Herkunft von Journalist:innen eine Leerstelle.
2020 veröffentlichte ich mein Buch „Working Class“. Es ging um Menschen, die allein von ihrer Arbeit leben, kaum Erspartes haben, kein Kapital. Das Buch wurde viel gelesen und diskutiert, aber in Interviews fragten Kolleg:innen oft etwas, das mich – bei allem Wohlwollen – irritierte: Sie fragten, was mein Impuls gewesen sei, über die Menschen am Rande der Gesellschaft zu berichten.
Die Menschen, die ich traf, arbeiten in der Reinigung, als Honorarkraft in der Musikschule, als Verkäufer, im Büro. Sie erzählten von großer Unsicherheit, von dem Gefühl, sich keinen Wohlstand aufbauen zu können, von der Sorge, im Alter nicht von der Rente leben zu können. Aber weder ihr Einkommen, noch ihre Berufe, noch die Tatsache, dass sie kaum Vermögen hatten, rückte sie an den Rand. Der mittlere Deutsche hat (als Single) 1900 Euro (netto) im Monat zur Verfügung (Niehues und Stockhausen 2019), auf seinem Konto liegen knapp 20 000 Euro, die Wahrscheinlichkeit, dass er zur Miete wohnt, ist hoch. Die Menschen, die ich traf, waren dieser statistischen sozialen Mitte relativ nahe, näher offensichtlich, als die Lebenswelt vieler, die mich zu meinen Recherchen befragten.
Als Forscher:innen der Universität Konstanz Menschen baten, sich selbst anhand ihres Einkommens einer Schicht zuzuordnen, drängten sich am Ende die meisten Datenpunkte in der Mitte. „Die Analyse zeigt, dass die Befragten im Vergleich zu ihrem tatsächlichen Einkommen eher dazu neigen, sich im Bereich der mittleren Stufen zu platzieren, auch und insbesondere dann, wenn sie eigentlich wesentlich ärmer oder reicher als der Durchschnitt sind“, so das Fazit der Autor:innen (Bellani et al 2021). Und weiter: „Mutmaßlich hängt dieses Phänomen auch damit zusammen, mit wem sich Menschen vergleichen: nämlich mit Personen, mit denen sie regelmäßig interagieren und sozial relevante Merkmale teilen.“ (ebd.) Will heißen: Wir neigen dazu, den Lebenstandard, den wir von uns und unseren Freunden kennen, als ziemlich durchschnittlich, als Standard, als normal einzuschätzen - selbst, wenn wir von der statistischen Mitte ziemlich weit entfernt sind. Ein Prinzip, vor dem auch Journalist:innen nicht gefeit sind.
„Oft wird Journalismus aus einer Haltung gemacht, die oben drüber steht, die herabschaut“, sagt Mareice Kaiser. Man merke Texten, Sprache und Protagonist:innenauswahl an, dass der Blickwinkel der von Menschen sei, die „5000 Euro im Monat verdienen“, aber noch nie unter Mindestlohn geputzt hätten.
„Wenn in der ZEIT Texte über normale Leute erscheinen, finden meine Kollegen das immer super, aber auch ungewöhnlich“, sagt Anna Mayr. Die Sprache sei immer wieder exotisierend, staunend würde über den Arbeitslosen berichtet, der sich in einer Maßnahme bewährt, in einer Sprache als sei er ein kleines Kind. Aus normalen Mietwohnungen würden Wohnwaben, in Fotostrecken über Kinderschreibtische ist es erwähnenswert, wenn ein Kind im Plattenbau lebt, so Mayr. Bei anderen Protagonist:innen sei dann aber schlicht zu lesen: Sie lebt mit ihren Eltern in Stuttgart, verschwiegener Subtext: in einem Haus, wie wir alle groß wurden.[1]
Eine Fernsehredakteurin erzählt mir, dass in ihrer Sendung Handys angepriesen wurden, die mehr kosten als der bzw. die durchschnittliche Zuschauer:in im Monat zur Verfügung hat – ohne die hohen Preise als solche zu thematisieren. Selten aber legen die Journalist:innen das eigene, verzerrte Normal so treuherzig offen wie ein Autor des SZ-Magazins bei einer Reportage über die Partei „Die Linke“ – ein All-time-favourite. „In meiner Familie ist keiner arbeitslos“, schrieb Tobias Haberl (2009), „keiner in einer Gewerkschaft, die meisten sind selbstständig, gut situiert, viele Ärzte, ein paar Anwälte, einer hat eine ‘Burger-King’-Filiale am Bodensee. Ich weiß noch, wie ich erschrocken bin, als ich zum ersten Mal einen Schulfreund besuchte, der mit seinen Eltern in einer 75-Quadratmeter-Mietwohnung lebte.“
„Ich glaube, dass es sehr helfen würde, wenn es mehr Journalist:innen mit einer Arbeiter:innen-Perspektive geben würde“, sagt Daniel Drepper. „Gerade auch in Führungspositionen. Die ein Gefühl dafür haben, wie der Alltag für einen Großteil der Menschen aussieht, wie wenig Geld Durchschnittsmenschen in Deutschland verdienen und welche Probleme Arbeitnehmer:innen tagtäglich haben.“ „Dadurch, dass Journalismus von einem elitären Teil der Gesellschaft gemacht wird, ist er auch elitär. Benutzt akademische Codes, schaut aus einer privilegierten Perspektive auf Geschichten, berichtet in komplexer Sprache, statt in einfacher“, schreibt Mareice Kaiser. „Es würde den Journalismus besser machen“, sagt Anna Mayr schlicht.
Noch Zweifel? Dann sei eine Folge aus der Literaturreihe „reiten und streiten“ des SWR (2021) empfohlen. Das Prinzip: Literatur-Agent, Übersetzer und Buchkritiker Denis Scheck und Bestseller-Autorin und Juristin Juli Zeh striegeln und satteln ihre Pferde, um dann auf einem Spazierritt über Bücher zu parlieren. Im Sommer 2021 besprachen sie das Buch „Die Elenden“, das Anna Mayr über die Verachtung von Arbeitslosen geschrieben hat. Bevor er aufsitzt, spottet Scheck noch, er sei als Moderator ja so arm, dass er sich als Pferdepfleger etwas dazuverdienen müsse, dann thronen die beiden – Zeh in stilechter Ausreitgarnitur – hoch zu Ross. Scheck echauffiert sich: „Dieses Buch von Anna Mayr ging mir wahnsinnig auf den Senkel. Sie läuft in die Larmoyanz-Falle.“ Auch Juli Zeh ist nicht überzeugt, räumt ein, dass das Sujet Arbeitswelt ja durchaus eines sei, aber ausgerechnet Arbeitslosigkeit dann doch der falsche Schwerpunkt. Sie hätte lieber ein Buch über Burn-Out gelesen, weil sie von Bekannten erfahren habe, dass das ein Thema sei. Und während die beiden Kritiker:innen ihr Pferde anbinden, wünscht man sich als Zuschauerin, ein:e Working-Class-Kolleg:in in der Redaktion hätte ihnen sagen können, dass das Gesamtbild in dieser Folge kein Gutes war.
[1] Immerhin, das betont Mayr, gäbe es in der Redaktion aber eine große Offenheit, Kritik zu diesem „Social Bias“ anzuhören und anzunehmen
Die Autorin

Julia Friedrichs arbeitet als Autorin von Reportagen und Dokumentationen für die ARD, das ZDF und die Zeit. Mit dem Redaktionsteam „docupy“ brachte sie den Film „Ungleichland“ heraus. Sie hat mehrere hochgelobte Bücher verfasst, zuletzt „Working Class. Warum wir Arbeit brauchen, von der wir leben können“. Für ihre Arbeit erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen, u. a. den Axel-Springer-Preis für junge Journalisten, den Grimme-Preis und den Otto Brenner Preis für kritischen Journalismus.
Literatur
Die Links wurden am 21. Juni 2022 zuletzt überprüft.
- Bellani, L., Bledow, N., Busemeyer M.R., & Schwerdt, G. (2021, 26. Mai). Wenn alle Teil der Mittelschicht sein wollen: (Fehl-)Wahrnehmungen von Ungleichheit und warum sie für Sozialpolitik wichtig sind. Das Progressive Zentrum. https://www.progressives-zentrum.org/wp-content/uploads/2021/05/Policy_Paper_06_Bledow-Bellani.pdf
- David, O. (2021, 10. Juni). Praktikumsvergütung im Journalismus. Wo keine Villa ist, ist auch kein Weg. Übermedien. https://uebermedien.de/60748/wo-keine-villa-ist-ist-auch-kein-weg/
- Deutsche Journalistenschule (o.J.). DJS. Studierende. https://djs-online.de/djs-schueler/
- Deutscher Journalisten-Verband (o.J.). Journalistisches Praktikum. https://www.djv.de/startseite/info/themen-wissen/aus-und-weiterbildung/praktikum
- Fries, T. (2020, 13. August). SZ Werkstatt: Wie sieht die Ausbildung zum Redakteur aus? Süddeutsche Zeitung. https://www.sueddeutsche.de/kolumne/sz-werkstatt-wie-sieht-die-ausbildung-zum-redakteur-aus-1.4998705
- Haberl, T. (2009, 17. September). Mein Jahr in der Linkspartei. Süddeutsche Zeitung Magazin. https://sz-magazin.sueddeutsche.de/innenpolitik/mein-jahr-in-der-linkspartei-76668
- Hartmann, M. (2018). Die Abgehobenen. Wie die Eliten die Demokratie gefährden. Frankfurt am Main u. a.: Campus.
- Hinter den Zeilen (2022, 20. Januar). #18 Was hast du studiert? Nichts! https://hinterdenzeilen.de/2022/01/18-was-hast-du-studiert/
- Kaiser, M. (2022). Mein Leben ohne Harvard-Hoodie. In F. Macioszek, & J. Knop (Hrsg.), Klassenfahrt. 63 persönliche Geschichten zu Klassismus und feinen Unterschieden. Münster: edition assemblage
- Katz, J. (2021, 17. Mai). Prekäre Arbeitsbedingungen im Journalismus. Nicken bis zum Schleudertrauma. Katapult. https://katapult-magazin.de/de/artikel/nicken-bis-zum-schleudertrauma
- Kirsch, M. (2019). Die soziale Herkunft der Bewerber an deutschen Journalistenschulen. Masterarbeit. München.
- Kracke, N., Buck, D., & Middendorff, E. (2018). Beteiligung an Hochschulbildung. Chancen(un)gleichheit in Deutschland. DZHW-Brief, 03/2018. https://www.dzhw.eu/pdf/pub_brief/dzhw_brief_03_2018.pdf
- Kraemer, L., Tautz, D., & Hagemann, N. (2020, 4. November). Datenprojekt. Wie divers ist der ARD-Nachwuchs? Journalist. https://www.journalist.de/startseite/detail/article/wie-divers-ist-der-ard-nachwuchs
- Lueg, K. (2012). Habitus, Herkunft und Positionierung. Die Logik des journalistischen Feldes. Wiesbaden: Springer VS
- Meedia (2011. 18. April). Publishing. Wie die Süddeutsche ihre Volontäre rekrutiert. https://meedia.de/2011/04/18/wie-die-suddeutsche-ihre-volontare-rekrutiert
- Niehues, J., & Stockhausen, M. (2019). Einkommensverteilung nach sozioökonomischen Teilgruppen. IW-Kurzbericht, 53/2019. https://www.iwkoeln.de/studien/judith-niehues-maximilian-stockhausen-einkommensverteilung-nach-soziooekonomischen-teilgruppen-437725.html
- Pollak, R. (2021). Datenreport 2021. Vererbung von Klassenpositionen nach sozialer Herkunft. Bundeszentrale für politische Bildung. https://www.bpb.de/kurz-knapp/zahlen-und-fakten/datenreport-2021/sozialstruktur-und-soziale-lagen/330075/vererbung-von-klassenpositionen-nach-sozialer-herkunft/
- SWR (2021, 26. Mai). „lesenswert“: Streiten und Reiten mit Denis Scheck und Juli Zeh. Südwestrundfunk. https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/pressemeldungen/swrfernsehen-lesenswert-reitgespraeche-denis-scheck-juli-zeh-100.html
- Taz (o.J.). Praktikum in der taz: Wer – Wie – Was? https://taz.de/Praktikum-in-der-taz/!106576/
- Thomé, L. (2021). Tweet vom 05. Juni 2021, 13:18 Uhr. https://twitter.com/luisa_thome/status/1401136285897605120
Direkte Zitate ohne Quellenangabe stammen aus persönlich geführten Interviews oder nicht öffentlich zugänglichen Quellen, die der Autorin vorliegen.